Pflichtteilsanspruch
Pflichtteilsanspruch – wer erbt in welcher Reihenfolge?
Jeder Mensch kann im Grunde frei über sein Vermögen verfügen, dies bedeutet auch, dass er frei bestimmen kann, was mit seinem Vermögen nach seinem Tode geschehen soll.
Doch gibt es hier einige Einschränkungen. Ehe und Familie sind durch das Grundgesetz geschützt. Der Gesetzgeber trägt im Erbrecht diesem Schutz mit dem Pflichtteilsrecht Rechnung.
Auch hat der Erblasser eine Fürsorgepflicht gegenüber seiner Familie über den Tod hinaus. Deshalb ist eine Mindestbeteiligung für die engsten Angehörigen des Erblassers an der Erbmasse gesetzlich garantiert.
Pflichtteilsberechtigt sind nach § 2303 BGB die Abkömmlinge und der Ehegatte oder gleichgeschlechtliche eingetragene Lebenspartner des Erblassers. Sind keine Abkömmlinge vorhanden, so sind die Eltern des Erblassers pflichtteilsberechtigt.
Die Pflichtteilsberechtigten haben dann einen Pflichtteilsanspruch, wenn sie nach der gesetzlichen Erbfolge geerbt hätten, jedoch per Testament nichts oder weniger als den Pflichtteil (dann Pflichtteilsrestanspruch) bekommen sollen.
Die Höhe des Pflichtteils ist nach § 2303 BGB auf die Hälfte des gesetzlichen Erbteils festgelegt. Hier ist also zunächst zu schauen, wie groß der Nachlass ist und wer nach der gesetzlichen Erbfolge noch geerbt hätte.
Nach der gesetzlichen Erbfolge sind zuerst die Kinder, Ehepartner und eingetragene gleichgeschlechtlichen Lebenspartner des Erblassers erbberechtigt. Fällt einer dieser Erben aus, z.B. weil er schon vorverstorben ist oder die Erbschaft ausschlägt, so geht dessen Erbteil auf seine Kinder über.
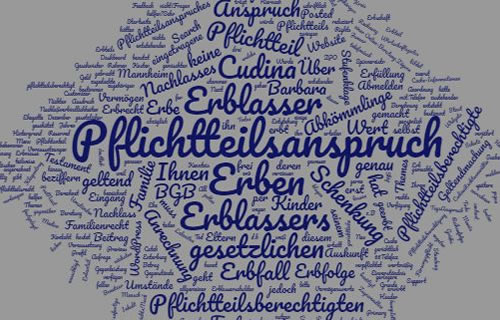
Sind keine Kinder, Ehepartner oder eingetragenen gleichgeschlechtlichen Lebenspartner als Erben des Erblassers vorhanden, so treten die Eltern des Erblassers in die Erbenstellung ein, fallen diese als Erben aus, so geht deren Erbanteil an deren Abkömmlinge über (Geschwister des Erblassers, danach Nichten und Neffen des Erblasser).
Sind überhaupt keine gesetzlichen Erben vorhanden, so erbt der Staat den Nachlass.
Der Pflichtteilsberechtigte wird nicht Erbe oder Miterbe des Nachlasses, er erwirbt mit dem Erbfall nur einen Anspruch gegen den oder die Erben auf Erfüllung des ihm zustehenden Pflichtteils in Geld.
Der Pflichtteilsanspruch entsteht mit dem Erbfall, wird jedoch erst mit der Geltendmachung fällig und ist dann auch zu verzinsen.
Der oder die Erben können nach § 2331 a BGB eine Stundung des Pflichtteilsanspruchs verlangen, wenn der Erbe selbst zum Kreis der Pflichtteilsberechtigten gehört und die sofortige Erfüllung des kompletten Pflichtteilsanspruches ihn zur Aufgabe der Familienwohnung oder eines Wirtschaftsgutes zwingen würde, was die Existenzgrundlage für ihn und seine Familie bildet.
Pflichtteilsanspruch Verjährung
Der Pflichtteilsanspruch verjährt in drei Jahren ab Kenntnis des Pflichtteilsberechtigten über die Umstände der Entstehung des Anspruches (Erbfall, Enterbung durch Verfügung von Todes wegen durch den Erblasser), wenn er nicht gerichtlich geltend gemacht wird.
Für eine gerichtliche Geltendmachung gelten wieder die allgemeinen Voraussetzungen der ZPO. Hiernach muss der geltend gemachte Anspruch im Klagantrag genau bezeichnet werden.
Kann der Pflichtteilsberechtigte nun den Anspruch nicht genau beziffern, da er den Wert des Nachlasses nicht kennt und nicht weiß, wer noch gesetzlicher Erbe gewesen wäre, so kann er mit einer Stufenklage erst einmal auf Auskunft klagen.
Der oder die Erben sind dann verpflichtet, genau Auskunft über die Umstände zu erteilen, welche zur Berechnung des Pflichtteilsanspruches benötigt werden. Sind diese Auskünfte erteilt, so kann der Pflichtteilsberechtigte im nächsten Schritt der Stufenklage den genauen Betrag beziffern und diesen geltend machen.
Berechnet wird der Wert des Nachlasses nach dem Verkehrswert der zugehörigen Gegenstände und Vermögenswerte abzüglich der Erblasserschulden (Verbindlichkeiten, die vom Erblasser selbst stammen) und Erbfallschulden (Verbindlichkeiten, die durch den Erbfall entstanden sind).
Wurde dem Pflichtteilsberechtigten zu Lebzeiten eine Schenkung vom Erblasser gemacht, so muss sich diese unter Umständen auf seinen Pflichtteil anrechnen lassen und sein Pflichtteilsanspruch reduziert sich dann wertmäßig um die schon zugedachte Schenkung.
Bei einer gemischten Schenkung, d.h. der Erblasser hat eine geringere oder nur teilweise eine Gegenleistung erhalten, wird der Wert des unentgeltlich Zugewandten (Überschuss) angerechnet.
Voraussetzung für eine Anrechnung ist, dass der Erblasser bei oder vor der Schenkung die Anrechnung auf den Pflichtteil des Empfängers bestimmt und deutlich zum Ausdruck gebracht hat.
Eine spätere Anordnung zur Anrechnung per Testament ist nicht möglich.
Wir sind für Sie da!
Wie können wir Ihnen helfen?
Sehr gerne beantworten wir Ihre Fragen auch im Rahmen einer Online-Beratung.
Zögern Sie bitte nicht!
Fragen kostet noch nichts!
Nach Eingang Ihrer Anfrage melden wir uns kurzfristig bei Ihnen und teilen Ihnen in diesem Zusammenhang auch die entstehenden Kosten einer Beratung, – sei es telefonisch, schriftlich oder persönlich, mit.
Telefon 0049 (0) 621 789 77 66
Telefax 0049 (0) 621 789 60 99
Email: info@fachanwalt-erbrecht-mannheim.de
Barbara Cudina
Rechtsanwältin – Fachanwältin für Familienrecht – Fachanwältin für Erbrecht – Mediatorin
68307 Mannheim – Spinnereistr. 3-7, Eingang rechts

